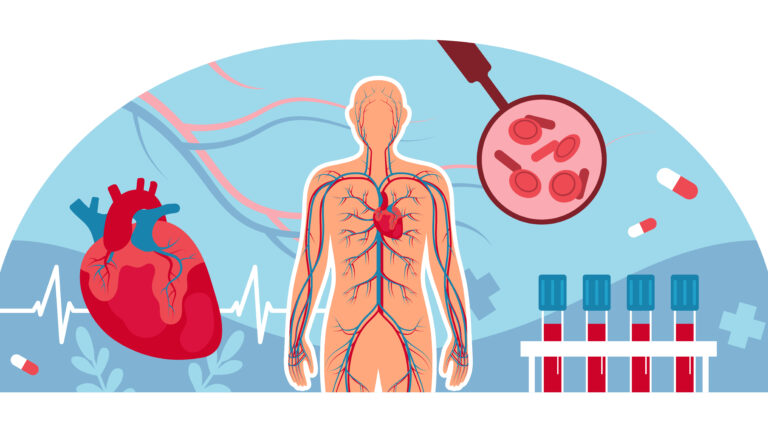Unser Herz pumpt etwa fünf Liter Blut pro Minute durch unseren Körper. Dabei fungieren vier Herzklappen als Ventile, die dafür verantwortlich sind, dass das Blut in die richtige Richtung fließt. Wenn eine dieser Klappen nicht mehr richtig funktioniert, sich also beispielsweise zu wenig öffnet oder undicht ist, kann das akut oder über längere Zeiträume fatal für unser lebenswichtigstes Organ sein. Über kleinste Einschnitte können Herzchirurginnen und -chirurgen die betroffene Klappe minimalinvasiv reparieren oder ersetzen.
Aortenklappe, Mitralklappe, Pulmonalklappe und Trikuspidalklappe, so heißen die vier Klappen, die für den korrekt gerichteten Blutfluss im Herz-Kreislauf-System verantwortlich sind. Alle vier sitzen mitten im Herzen und funktionieren wie eine Art Rückschlagventil für unser Blut. Wenn wir unser Herz schlagen hören, sind es zumeist die Klappen, die ihre Arbeit verrichten. Bei einer Herzfrequenz von 60 Schlägen pro Minute öffnen und schließen sich die Herzklappen an nur einem Tag rund 86.400-mal. Das sauerstoffarme Blut fließt dabei zunächst in den rechten Vorhof, dann in die rechte Kammer und von dort über die Lungenarterie in die Lunge, wo es Sauerstoff aufnimmt und Kohlendioxid abgibt. Das sauerstoffreiche Blut kehrt über die Lungenvene in den linken Vorhof zurück und gelangt in die linke Herzkammer. Von dort wird das Blut mit hohem Druck über die Aorta in den großen Körperkreislauf gepumpt. Ganz schön viel Arbeit für die kleinen Herzklappen.
Routinebehandlung bei Erkrankung
Besonders im Alter kann es daher zu Erkrankungen der Klappen kommen. Die häufigste krankhafte Herzklappenveränderung ist die sogenannte Aortenstenose. Dabei ist das Ventil zur Hauptschlagader (Aorta) beispielsweise durch Kalkablagerungen so verengt, dass das Herz immer mehr Kraft aufwenden muss, um das sauerstoffreiche Blut in die Blutbahnen weiter zu transportieren. „Eine unbehandelte Aortenstenose führt zu einer Linksherzinsuffizienz, also einer Schwäche der linken Herzkammer. Dies äußert sich zunächst durch zunehmende Atemnot und Leistungsminderung. Wenn diese Symptome auftreten, müssen wir schnellstmöglich handeln, da ein drohendes Pumpversagen der linken Herzkammer droht. Es kann zum Blutstau in der Lungenstrombahn führen und schließlich ein lebensbedrohliches Lungenödem verursachen“, so Univ.-Prof. Dr. med. Ajay Moza, Klinikdirektor der Klinik für Herzchirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen, über die möglichen Folgen rasch fortschreitenden Krankheit. „Das Gute ist, es steht uns ein großes Portfolio an sehr erfolgversprechenden Behandlungsoptionen zur Verfügung. Die Erfolgsaussichten auf eine erfolgreiche Therapie sind für die Patientinnen und Patienten sehr hoch.“
Ein Herzklappenersatz ist für die Herzchirurginnen und Chirurgen meistens eine Routineoperation. Immer häufiger erfolgt diese über eine sogenannte minimalinvasive Thorakotomie anstatt einer teilweisen oder kompletten Spaltung des Brustbeins. Der Herzklappenersatz wird dabei über einen kleinen Schnitt seitlich am Brustkorb (Thorax) vorgenommen. Im Gegensatz zu einer anderen minimalinvasiven Methode, bei der die Herzklappe über die Blutgefäße eingebracht wird (TAVI), werden bei der herzchirurgischen Operation die verkalkten, stark eingeengten Herzklappen komplett entfernt und eine neue Herzklappe durch Nähte fest verankert. „In einigen Fällen rekonstruieren wir die Aortenklappe, bei schweren Verkalkungen ist jedoch ein Ersatz durch eine biologische oder mechanische Klappenprothese notwendig. Wir verfahren dabei immer häufiger minimalinvasiv über einen kleinen Hautschnitt oberhalb der rechten Brustwarze“, erklärt Klinikdirektor Prof. Moza den nach der Operation kaum sichtbaren Zugang zum Herzen.
Biologisch oder aus Carbon
Eine Klappenprothese kann entweder aus biologischem Gewebe bestehen oder mechanisch sein. Die biologische Variante besteht aus tierischem Gewebe vom Schwein oder Rind, die mechanischen Klappenflügel aus Carbon. Beide habe ihre Vor- und Nachteile: Während die mechanische Klappenprothese ein Leben lang hält, besitzen biologische Herzklappen eine durchschnittliche Lebensdauer von etwa 15 Jahren. Bei der mechanischen Klappe müssen Betroffene jedoch lebenslang Medikamente zur Steuerung der Blutgerinnung einnehmen, wohingegen die biologische Klappenprothese keine Medikamente erfordert. Da sich die Herzklappen zudem stetig in ihrer Langlebigkeit verbessern, werden immer häufiger biologische Prothesen implantiert.
Rekonstruktion statt Austausch
Bei der zweithäufigsten Herzklappenerkrankung, der sogenannten Mitralklappeninsuffizienz, ist ein minimalinvasiver chirurgischer Zugang etabliert. Hier ist die erste Option immer eine Rekonstruktion der körpereigenen Herzklappe. Dabei resultiert die Undichtigkeit der Mitralklappe daraus, dass sich die beiden Klappensegel nicht mehr richtig treffen. Durch den fehlerhaften Klappenschluss pendelt ein Teil des Blutes zwischen dem linken Vorhof und der linken Herzkammer. Dieses zusätzliche Volumen belastet das Herz zunehmend. Neben angeborenen Klappensegelveränderungen liegen meistens altersbedingte Veränderung im Bereich der Verankerung der Klappensegel (Sehnenfäden) vor. Auch eine Vergrößerung der linken Herzkammer führt häufig dazu, das die Mitralklappensegel nicht mehr korrekt schließen. Die Rekonstruktion der körpereigenen Klappe kann über neue Sehnenfäden oder ein stärkendes Band um die Ansatzstelle der Herzklappe herum (Anuloplastie-Ring) geschehen. Zudem werden häufig auch Teile der Klappensegel zurechtgetrimmt. Der Zugang für eine Rekonstruktion der Mitralklappe erfolgt in der Regel über einen minimalinvasiven Schnitt im Bereich der fünften Rippe auf der rechten Brustkorbseite.
Die Aorta hat einen Durchmesser von etwa 2,5 – 3,5 cm und ist mit 30 bis 40 cm Länge das größte Blutgefäß des Menschen. Sie entspringt dem Herzen nach oben und zieht nach einer 180 Grad Wende im Brustkorb bis weit in den Bauchraum, wo sie unter anderem Arterien zum Darm, zur Leber und zu den Nieren abgibt und sich dann in die Beckenarterien aufspaltet. Aufgrund der Größe und der Lage der Aorta fällt eine Erkrankung nicht nur in das Fachgebiet der Herzchirurgie. An der Uniklinik RWTH Aachen arbeitet die Klinik für Herzchirurgie daher in Fällen, die die Hauptschlagader im absteigenden Teil betreffen, eng mit der Klinik für Gefäßchirurgie zusammen.
Weitere Informationen zum Aortenzentrum finden Sie auf der Homepage der Klinik für Herzchirurgie der Uniklinik RWTH Aachen.