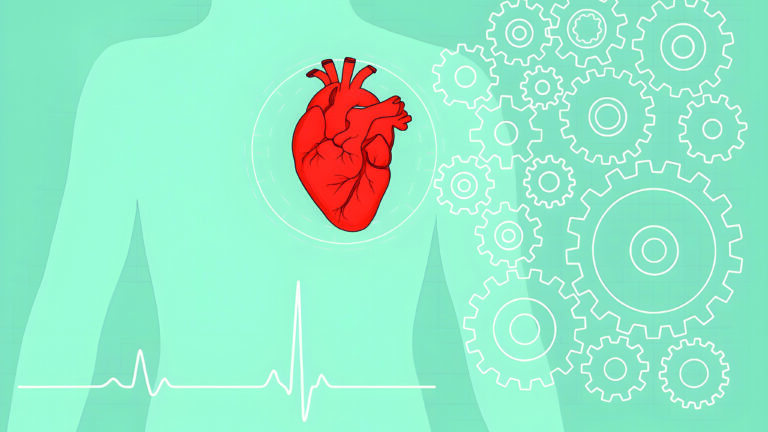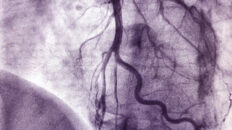Herzerkrankungen beeinträchtigen die Lebensqualität und sind im schlimmsten Fall lebensbedrohlich. Wenn Medikamente und Verhaltensumstellungen nicht mehr helfen, sind operative Eingriffe oft die letzte Möglichkeit. apropos stellt die bekanntesten Operationen vor.
Bypassoperation:
Unermüdlich pumpt das Herz eines erwachsenen Menschen etwa 5 Liter Blut pro Minute durch unsere Blutgefäße. Um diese Dauerleistung zu erbringen, benötigt der Herzmuskel selbst eine ausreichende Blutversorgung. Die Herzkranzgefäße gewährleisten die Blutversorgung. Das sind drei Arterien, die dafür sorgen, dass Sauerstoff und Nährstoffe die Herzmuskelzellen erreichen. Leider können sich die Arterien durch Ablagerungen oder Verkalkungen verengen, sodass der Muskel nicht mehr ausreichend durchblutet wird. Der Fachbegriff hierfür lautet „Koronarstenosen“. Das dazugehörige Krankheitsbild ist die koronare Herzkrankheit (abgekürzt KHK). Klassische Symptome sind Brustschmerzen, Schmerzen, die in den linken Arm ausstrahlen, Engegefühl und Atemnot. Bilden sich die Symptome zurück, spricht man von einer Angina pectoris. Bleiben die Symptome länger bestehen, kann es sich um einen Infarkt handeln.
In Zusammenarbeit mit der Kardiologie legt die Herzchirurgie eine gemeinsame Behandlungsstrategie für Patientinnen und Patienten mit der Diagnose „Koronare Herzerkrankung“ fest. In vielen Fällen ist die sogenannte Bypassoperation die beste Therapieoption. Das Ziel der Operation ist es, eine ausreichende Durchblutung des Herzmuskels zu ermöglichen. Dazu legen die Chirurginnen und Chirurgen mit körpereigenen Blutgefäßen eine Art „Umgehungsstraße“ (Bypass) um die Engstelle im Koronargefäß herum, sodass das Herz ausreichend durchblutet wird und es nicht zu einem Infarkt kommt. Die Operation findet in der Regel am offenen Herzen statt. Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte entscheiden für jeden Fall individuell, ob die Operation am schlagenden Herzen oder mit Hilfe einer Herz-Lungen-Maschine erfolgt. In bestimmten Fällen ist eine minimalinvasive Operation möglich, bei der das Brustbein nicht geöffnet werden muss.
Die Bypassoperation ist die häufigste Operation in der Herzchirurgie und zeigt sehr gute Ergebnisse mit hervorragender Langzeitprognose und erhöhter Lebensqualität.
Herzklappenoperation
Operationen an den Herzklappen gehören neben der Bypassoperation zu den häufigsten Eingriffen im Bereich der Herzchirurgie. Meist betreffen sie die Aorten- oder die Mitralklappe. Durch Verkalkung, Entzündung oder angeborene Defekte verlieren die Klappen ihre Ventilfunktion und schränken somit die Funktion akut oder schleichend ein. Expertinnen und Experten sprechen von einer Klappenstenose, wenn die Öffnungsfläche der Herzklappe zu klein ist und von einer Klappeninsuffizienz, wenn die Klappe nicht mehr richtig schließt und dadurch undicht ist. Betroffene leiden unter anderem unter Kurzatmigkeit, Herzrasen, Schwindel oder Leistungsminderung durch eine beginnende Herzschwäche. „Für Eingriffe an den Klappen gibt es je nach betroffener Klappe und Art der Erkrankung unterschiedlichen Verfahren und Zugangswegen“, erklärt Dr. med. Haushofer, Oberarzt der Klinik für Herzchirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen. „Bei der klassischen Operation am offenen Herzen entfernen wir die erkrankte Klappe komplett. Dies geschieht in Vollnarkose und mit dem Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine. Nach genauer Operationsplanung erlauben es uns minimalinvasive Techniken immer besser, die Operation durch einen kleinen Schnitt, zum Beispiel entlang der Rippen, durchzuführen, ohne das Brustbein zu öffnen. Häufig gelingt es, eine Klappe so zu rekonstruieren, dass keine Klappenprothese benötigt wird.“
Herzunterstützungssysteme und Transplantation
Patientinnen und Patienten, bei denen alle anderen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind, bleiben zwei Optionen: Eine Transplantation oder die Implantation eines mechanischen Herzunterstützungssystems. Da Spenderorgane in zu geringer Anzahl zur Verfügung stehen, stabilisieren Unterstützungssysteme kritisch kranke Patientinnen und Patienten und überbrücken die Wartezeit auf ein passendes Spenderherz. Ärztinnen und Ärzte können ein Linksherzunterstützungssystem auch als dauerhafte Lösung implantieren.
Hierbei implantieren sie eine kleine, elektrisch betriebene Pumpe in die linke Herzkammer. Sie unterstützt oder ersetzt die Pumpleistung des geschwächten Herzens und sorgt dafür, dass das Blut ausreichend durch den Körper zirkuliert. Das System ist über ein dünnes Kabel mit einer extern getragenen Energieversorgung verbunden. „Dank moderner Technik können viele unserer Patienten mit einem solchen System wieder aktiv am Leben teilnehmen“, sagt Dr. med. Haushofer. „Gleichzeitig gewinnen wir wertvolle Zeit, bis ein geeignetes Spenderorgan zur Verfügung steht. Bei den Transplantationen kooperieren wir eng mit der Uniklinik in Düsseldorf. In einigen wenigen Fällen wurde an der Uniklinik RWTH Aachen auch schon ein komplettes Kunstherz implantiert.“
Im Notfall setzen die Behandelnden eine kurzfristige Kreislaufunterstützung durch externe Pumpensysteme – sogenannte ECMO- oder ECLS-Systeme – ein. Diese Maßnahmen verschaffen dem geschwächten Herzen Zeit zur Erholung oder überbrücken kritische Phasen bis zur weiterführenden Behandlung.
Gut zu wissen: Herz-Lungen-Maschine
Um das Herz während einer Operation ruhig zu stellen, implantiert das Behandlungsteam eine Herz-Lungen-Maschine. Diese übernimmt den Blutkreislauf und die Sauerstoffversorgung des Körpers, insbesondere des Gehirns. Über ein Schlauchsystem wird sauerstoffarmes Blut aus dem Körper entnommen und mittels eines Oxygenators mit Sauerstoff angereichert, um dann mit Druck in die Hauptschlagader (Aorta) zurückgegeben zu werden. Ein Wärmeaustauscher senkt die Blut- und Körpertemperatur mit dem Ziel, den Sauerstoffbedarf zu reduzieren und somit empfindliche Organe vor Sauerstoffmangel zu schützen.